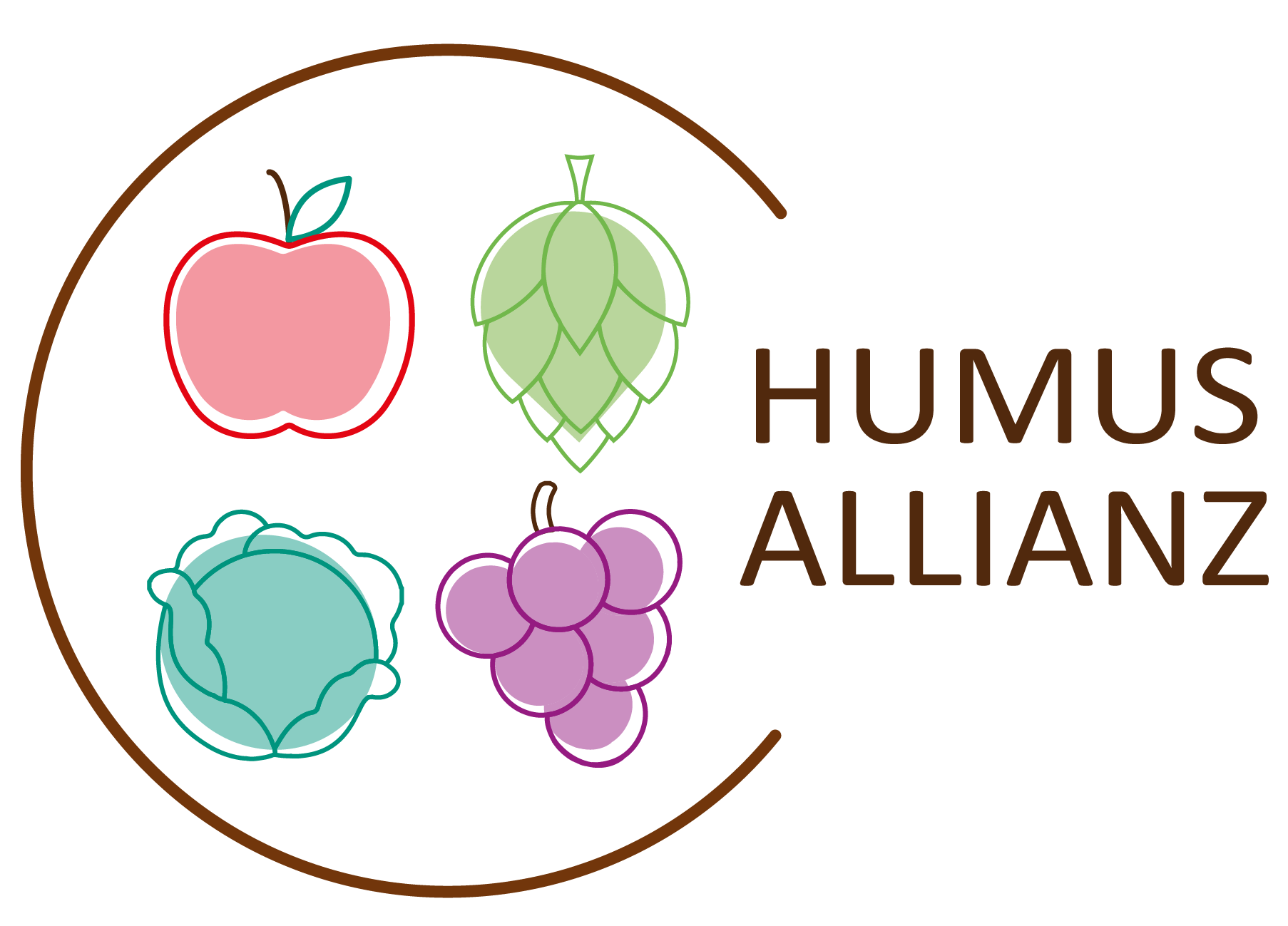Humusaufbau in Sonderkulturen – Maßnahmen zur Kohlenstoffsequestrierung im Rahmen der HumusAllianz
Durch die Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre über die Photosynthese und die anschließende Einlagerung organischer Substanz in Böden kann ein wirksamer Beitrag zur Reduktion des atmosphärischen CO₂-Gehalts geleistet werden. Dieser Prozess der biologischen Kohlenstoffsequestrierung zählt zu den zentralen Ansätzen einer klimawirksamen Landbewirtschaftung. Neben dem Klimaschutz bietet der Humusaufbau eine Vielzahl agronomischer Vorteile, darunter eine verbesserte Nährstoffdynamik, eine erhöhte Wasserspeicherkapazität sowie eine gesteigerte Resilienz landwirtschaftlicher Systeme gegenüber extremen Wetterereignissen.
Im Rahmen des Projekts HumusAllianz wurden zehn prioritäre Maßnahmen identifiziert, die nachweislich ein besonderes Potenzial zur Förderung des Humusaufbaus in Sonderkulturen besitzen. Alle ausgewählten Maßnahmen basieren auf wissenschaftlicher Evidenz hinsichtlich ihrer positiven Wirkungen auf die Kohlenstoffsequestrierung und Bodenfruchtbarkeit. Sie werden auf rund 100 landwirtschaftlichen Demonstrationsbetrieben bundesweit unter regions- und betriebsspezifischen Bedingungen praxisnah umgesetzt und wissenschaftlich begleitet. Ziel ist es, wirksame und übertragbare Strategien zur nachhaltigen Verbesserung der Bodenqualität und zur langfristigen Bindung von Kohlenstoff in landwirtschaftlich genutzten Böden zu entwickeln, zu evaluieren und sichtbar zu machen.
Nachfolgend sind die zehn ausgewählten Maßnahmen in der Übersicht aufgeführt und anschließend im Einzelnen beschrieben:
1. Verbesserte Fruchtfolge
Auch im Bereich der Sonderkulturen kann eine durchdachte Fruchtfolge zur Steigerung des Humusgehalts beitragen. Durch den Anbau humusmehrender Zwischenkulturen, tiefwurzelnder Arten und Leguminosen zwischen den Hauptkulturen – etwa während Neuanlagen oder Umstellungsjahren – lässt sich die organische Substanz im Boden gezielt erhöhen. Der Fokus liegt dabei auf einer ausgewogenen Bilanz zwischen Humusaufbau und -abbau.
2. Verkürzte Brachezeit – Zwischenfrüchte, Begrünung und Untersaaten
Unproduktive Zeiträume ohne aktive Durchwurzelung des Bodens sollten möglichst kurz gehalten werden. Zwischenfrüchte, dauerhafte Begrünungen und Untersaaten erhöhen die Bodenbedeckung, verbessern die Durchwurzelung, reduzieren Erosion und fördern über Wurzelexsudate sowie abgestorbene Biomasse den Humusaufbau. In mehrjährigen Kulturen spielt insbesondere die Begrünung der Fahrgassen eine zentrale Rolle.
3. Agroforstsysteme
Die Integration von Gehölzen wie Bäumen, Sträuchern oder Hecken in Dauerkulturen – beispielsweise als Windschutz, Randbepflanzung oder innerhalb der Anlage – fördert die Kohlenstoffbindung sowohl in der Biomasse als auch im Boden. Agroforstsysteme bieten zusätzliche ökologische Leistungen wie Mikroklimastabilisierung, Biodiversitätsförderung und Erosionsschutz und tragen langfristig zur Stabilisierung des Humusgehalts bei.
4. Reduzierte Bodenbearbeitung
Die Vermeidung intensiver oder tiefer Bodenbearbeitung schützt die Bodenstruktur und das Bodenleben. Besonders in Hanglagen oder bei erosionsgefährdeten Böden kann eine reduzierte Bearbeitung oder ein völliger Verzicht auf mechanische Eingriffe dazu beitragen, die bestehende organische Substanz zu erhalten und mikrobiologische Prozesse zu fördern, die den Humusabbau verlangsamen.
5. Mulch
Mulch ist organisches Material, das auf die Bodenoberfläche aufgebracht wird, um den Boden zu schützen und dessen Fruchtbarkeit zu fördern. Verwendet werden können etwa Schnittgut aus der Fläche selbst, z. B. aus Begrünungen oder Untersaaten, sowie organisches Material von externen Flächen – sogenannter Transfermulch – wie Kleegras, Grünlandaufwuchs oder Zwischenfrüchte. Mulch schützt die Bodenoberfläche vor Erosion, unterdrückt Unkraut, verbessert die Wasserspeicherung und fördert den Humusaufbau. Bei extern eingebrachtem Material ist auf eine standortnahe Herkunft zu achten, um Nährstoffverlagerungen und Transportemissionen zu minimieren.
6. Integrierte Tierhaltung
Mobile Weidesysteme mit Schafen, Geflügel oder anderen Tieren können effektiv zur Humusanreicherung beitragen. Die Tiere liefern Nährstoffe über Kot und Urin, lockern den Boden mechanisch auf und tragen zur Einarbeitung organischer Substanz bei. Gleichzeitig kann der Tierbesatz helfen, Begrünungen zu regulieren, ohne dass maschinelle Maßnahmen notwendig sind.
7. Umveredelung statt Neupflanzung
Anstatt alte Bestände vollständig zu roden und neu anzulegen, kann durch die Umveredelung bestehender Bäume oder Rebstöcke die Humusstruktur geschont werden. So bleiben gewachsene Bodenprofile und Mykorrhiza-Netzwerke erhalten, und großflächige Bodenbewegungen mit entsprechenden Humusverlusten werden vermieden. Diese Maßnahme ist besonders relevant in älteren Anlagen mit guter Grundstruktur.
8. Ausbringung von Pflanzenkohle
Pflanzenkohle besitzt eine sehr stabile Kohlenstoffstruktur und verbleibt über Jahrzehnte im Boden. In Kombination mit organischen Materialien – etwa Kompost oder Gülle – verbessert sie die Nährstoff- und Wasserhaltefähigkeit sowie die mikrobielle Aktivität im Boden. Als „dauerhafte“ Kohlenstoffquelle trägt sie so zur langfristigen Humusstabilisierung bei.
9. Kalkung von Böden
Eine gezielte Kalkung reguliert den pH-Wert des Bodens und schafft so bessere Bedingungen für Bodenleben und mikrobielle Aktivität. Dies wiederum stabilisiert den Humusgehalt, insbesondere in Böden, die zur Versauerung neigen. Voraussetzung ist eine standortangepasste Anwendung auf Basis aktueller Bodenanalysen.
10. Externe Kohlenstoffquellen (< 20 %)
Organische Düngemittel wie Kompost, Mist oder Gärreste können den Humusgehalt erhöhen, sofern ihr Einsatz maßvoll erfolgt. Um das Risiko der Verlagerung von Humuswirkungen auf andere Flächen zu minimieren, sollte der Anteil externer organischer Substanz am Gesamt-Kohlenstoffeintrag unter 20 % liegen. Dabei ist insbesondere auf Herkunft, Qualität und Transportwege zu achten.
Die vorgestellten zehn Maßnahmen bilden eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für den gezielten Humusaufbau in Sonderkulturen. Ihre Umsetzung auf Demonstrationsbetrieben soll praxisrelevante Erkenntnisse über die Klimawirkung und agronomischen Effekte liefern. Im Folgenden werden die Maßnahmen im konkreten Bezug zu den vier Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) Apfel, Wein, Gemüse und Hopfen näher erläutert.