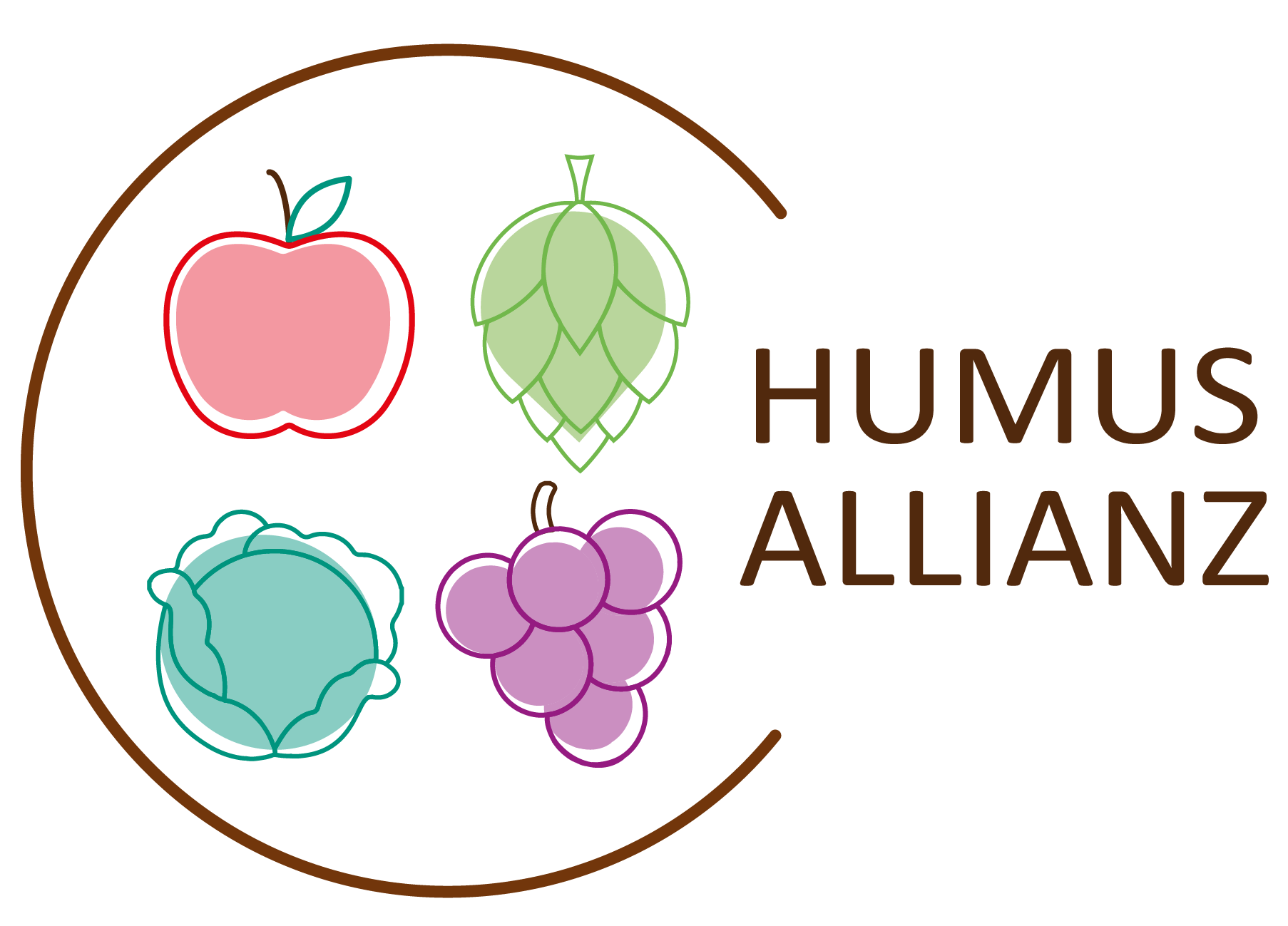Inhalt: Maßnahmenübersicht im Modell- und Demonstrationsvorhaben Bodenfruchtbarkeit und Klimaschutz durch Humuswirtschaft im Apfelanbau (ClimateApples)
Der Apfelanbau bietet vielfältige und bisher nicht flächendeckend genutzte Potenziale zur Förderung des Humusaufbaus und damit zur langfristigen Speicherung von Kohlenstoff im Boden. Unterschieden wird hierbei zwischen humusfördernden Maßnahmen bei der Rodung einer Altanlage bzw. der Neupflanzung und humusfördernden Maßnahmen in Ertragsanlagen.
Maßnahmen bei Neupflanzung
Gründüngung als Fruchtfolge zwischen Rodung und Neupflanzung
- Einsaat einer Gründüngung nach der Rodung
- Positive Fruchtfolgeeffekte auf Bodenfruchtbarkeit, Bodenleben, Wasserhaltekapazität
- reduzierte Erosion
- Erhöhung des Humusgehalts durch Auswahl tiefwurzelnder Arten
In einer Dauerkultur kann eine Fruchtfolge nur im Zeitraum zwischen Rodung und Neupflanzung der Anlage erfolgen. Diese Praxis hat nicht nur positive Auswirkungen auf den Humusgehalt, sondern trägt auch zur Förderung der Bodenbiologie bei. Durch die Integration einer Zwischenfrucht wird der Boden kontinuierlich mit organischer Substanz versorgt, was die Aktivität von Bodenorganismen wie Mikroben und Regenwürmern fördert. Diese erhöhen die Bodenfruchtbarkeit und verbessern die Nährstoffverfügbarkeit. Gleichzeitig verhindern die Pflanzenwurzeln die Erosion, indem sie den Boden stabilisieren und die Wasserhaltekapazität des Bodens verbessern. Außerdem kann eine Zwischenfrucht dazu beitragen, die Nährstoffverluste durch Auswaschung zu verringern und die Nitratbindung im Boden zu fördern, was insbesondere in Regionen mit hohen Niederschlägen von Bedeutung ist.
Die Wirkung der Zwischenfrucht auf den Humusaufbau lässt sich durch eine gezielte Auswahl der Arten, den optimalen Saatzeitpunkt und die passende Aussaattechnik optimieren. Diese Maßnahmen erhöhen den Beitrag der Pflanzen zur Humusanreicherung im Boden. Besonders tiefwurzelnde Arten können in tieferen Bodenschichten zusätzliche organische Substanz einbringen, die den Humusgehalt im Boden stabilisiert und fördert. Mehrjährige Kulturen, wie Kleegras(-gemenge) oder Kulturen zur energetischen Nutzung, entwickeln im Vergleich zu einjährigen Pflanzen ein deutlich größeres Wurzelsystem. Die daraus resultierende höhere Wurzelbiomasse trägt nachweislich positiv zum Humusaufbau bei.
Reduzierte Bodenbearbeitung bei der Neupflanzung
- Bodenbearbeitung nur im Baumstreifen und Erhalt der Fahrgasse bei Rodung und Neupflanzung
- Erhalt des über die Standzeit der Anlage aufgebauten Humus in der Fahrgasse
- Reduzierter Humusabbau durch geringere Belüftung
In der obstbaulichen Praxis werden verschiedene Verfahren bei der Bodenbearbeitung vor der Neupflanzung umgesetzt. Eine übliche Vorgehensweise ist die vollflächige Bodenbearbeitung, bei der sowohl ehemaliger Baumstreifen als auch die Fahrgasse mit der Grasnarbe aufgegrubbert werden. Durch die Bearbeitung der Fahrgasse, die langfristig durch die dauerhafte Begrünung Humus aufbaut, kann dieser aufgrund der Belüftung und damit verbundenen Aktivierung der Bodenlebewesen schnell umgesetzt und abgebaut werden. Der Humusgehalt sinkt entsprechend und muss nach der Neuanlage erneut aufgebaut werden. Alternativ ist es möglich, nur den Bereich des Pflanzstreifens partiell zu bearbeiten und so den bereits vorhandenen Humusgehalt weitestgehend zu bewahren.
Umveredelung
- Erhalt der Unterlagen und des Wurzelwerks einer zu rodenden Anlage
- Neue Veredelung mit Edelreisern der gewählten Sorte
- Humus und Bodenleben bleiben durch die fehlende Bodenbearbeitung erhalten
Bei einer Umveredelung werden die Unterlagen sowie das Wurzelwerk der zu rodenden Anlage erhalten. Auf den Stämmen erfolgt eine Veredelung mit den Edelreisern einer neuen Sorte. Dadurch wird im Gegensatz zur vollständigen Rodung der Altanlage kein Eingriff in den Boden vorgenommen, wodurch der Humusgehalt und das Bodenleben unbeeinflusst bleiben. Darüber hinaus ist dieses Verfahren wasser- und energieeffizienter und bietet eine geringere Anfälligkeit gegenüber Nagerschäden im Gegensatz zu einer herkömmlichen Neupflanzung. Außerdem erlaubt die Umveredelung eine schnelle und flexible Sortenanpassung an neue klimatische Bedingungen, Marktanforderungen oder Krankheitsresistenzen – ohne dass eine komplette Neuanlage mit hohen Kosten, Emissionen und Bodenbelastungen erforderlich ist.
Um eine Umveredelung erfolgreich durchzuführen, ist jedoch ein hohes Maß an Fachwissen erforderlich.


Einarbeitung von Pflanzenkohle in den Pflanzgraben
- Ausbringen von Pflanzenkohle in den Pflanzgraben
- Pflanzenkohle besteht größtenteils aus stabil gebundenem Kohlenstoff und kann u. a. aus gerodeten Apfelbäumen hergestellt werden
Pflanzenkohle besteht zu einem großen Teil aus stabil gebundenem Kohlenstoff, der im Boden über sehr lange Zeiträume erhalten bleibt und dort zur dauerhaften Kohlenstoffspeicherung beiträgt. Durch ihre Herstellung wird ein Teil des in den Bäumen gebundenen Kohlenstoffs in eine feste, schwer abbaubare Form überführt. Damit bietet Pflanzenkohle grundsätzlich ein erhebliches Potenzial zur Unterstützung von Klimaschutzstrategien. Werden die gerodeten Bäume der Altanlage zu Pflanzenkohle verarbeitet und die dabei freiwerdende Wärme energetisch genutzt, ist dieser Prozess klimaneutral. Die Pflanzenkohle kann als gebundener Kohlenstoff auf der gleichen Fläche ohne Verlagerungseffekte betrachtet werden.
Aufgrund der Aktivkohlewirkung und der damit verbundenen Bindung von Nährstoffen ist es empfehlenswert, Pflanzenkohle vorab mit organischem Material, beispielsweise Kompost, zu mischen. Ist die Pflanzenkohle beladen, kann sie bei der Neupflanzung im Pflanzgraben ausgebracht werden, ohne dass das Risiko besteht, dem Boden Nährstoffe zu entziehen, die dann den jungen Bäumen fehlen.
Die Kosten für Pflanzenkohle und ihre Ausbringung sind derzeit jedoch hoch und können je nach Aufwand mehrere Tausend Euro pro Hektar betragen. Deshalb eignet sich diese Maßnahme vor allem für Demonstrations- und Versuchsflächen, auf denen Erfahrungen gesammelt und Bewertungskriterien für eine künftige großflächige Anwendung entwickelt werden können. Eine wirtschaftlich tragfähige Umsetzung setzt langfristig eine Einbettung in Förderstrategien, Zertifizierungssysteme oder die gezielte Kombination mit anderen humusfördernden Maßnahmen voraus.

Maßnahmen in Ertragsanlagen
Einsaaten von tiefwurzelnden, biomassebildenden Arten
- Tiefwurzelnde Arten und Leguminosen in der Fahrgasse oder im Baumstreifen können die unterirdische Biomasse erhöhen
- Artenreiche Mischungen fördern zusätzlich Biodiversität und Bodenleben
In den vergangenen Jahren erfolgten bereits umfangreiche Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität innerhalb der Obstanlagen. Spezielle Blühmischungen wurden konzipiert und bereits auf einigen Praxisbetrieben eingesetzt. Bislang ist ein möglicher Einfluss dieser Einsaaten auf den Humusgehalt wenig untersucht. Neben den Blühmischungen können auch spezielle humusfördernde Einsaaten mit Fokus auf tiefwurzelnde Arten und Leguminosen in der Fahrgasse etabliert und im Gegensatz zur praxisüblichen, artenarmen Grasmischung eingesetzt werden.
Herausforderungen hierbei sind der bessere Schutz für Mäuse vor natürlichen Antagonisten durch den dichteren Bewuchs, sowie die höheren Auflagen bei Pflanzenschutzmaßnahmen, wenn blühende Pflanzen in der Fahrgasse vorhanden sind.


Transfer des Mulchmaterials aus der Fahrgasse in den Baumstreifen
- Nährstoffzufuhr durch Verlagerung des Mulchmaterials aus der Fahrgasse in den Baumstreifen
- Verdunstungsschutz
Das Mulchmaterial der Fahrgasse kann mit spezieller Technik in den Baumstreifen transferiert werden. Dort dient es der Nährstoffzufuhr und trägt als Bodenabdeckung zum Verdunstungsschutz bei. Zum Einfluss auf den Humusgehalt gibt es bisher wenige Erkenntnisse. Dieser soll daher weitergehend untersucht werden.

Ausbringen von Kalk und Gips
- Bildung von Ton-Humus-Komplexen und stabilere Krümelstruktur
- Erhöhung der Bodendurchlüftung, der Wasseraufnahmekapazität und Verbesserung des Nährstoffspeichervermögens
- Entgegenwirkung einer Versauerung
Kalk wirkt der zunehmenden Versauerung des Bodens entgegen. Es können Ton-Humus-Komplexe gebildet werden, sodass eine stabilere Krümelstruktur, mehr Bodendurchlüftung und Aufnahmekapazität für Wasser sowie ein verbessertes Nährstoffspeichervermögen entsteht. Das Bodenleben wird aktiviert und der Ab- und Umbau von org. Masse beschleunigt. Gips wirkt pH-neutral, hat aber eine ebenso positive Wirkung auf die Bodenlockerung durch die Tonflockung durch Calcium.
Ausbringen von organischer Substanz (z.B. Kompost, Gärreste, Mist) in den Baumstreifen
- Förderung der Bodenstruktur und des Bodenlebens
- Verdunstungsschutz
Das Ausbringen von organischem Material wie beispielsweise Gärresten, Kompost, Champost oder Mist verfolgt verschiedene Ziele. Neben der Reduzierung der Wasserverdunstung bei einer Auflage kann organisches Material, wenn es eingearbeitet wird, das Bodenleben und die Bodenstruktur fördern. Die humusfördernde Wirkung der Maßnahme soll demonstriert werden. Hierbei handelt es sich meist um zumindest teilweise extern (nicht auf der gleichen Fläche) gebundenen Kohlenstoff, sodass es zu einem Verlagerungseffekt kommen kann.