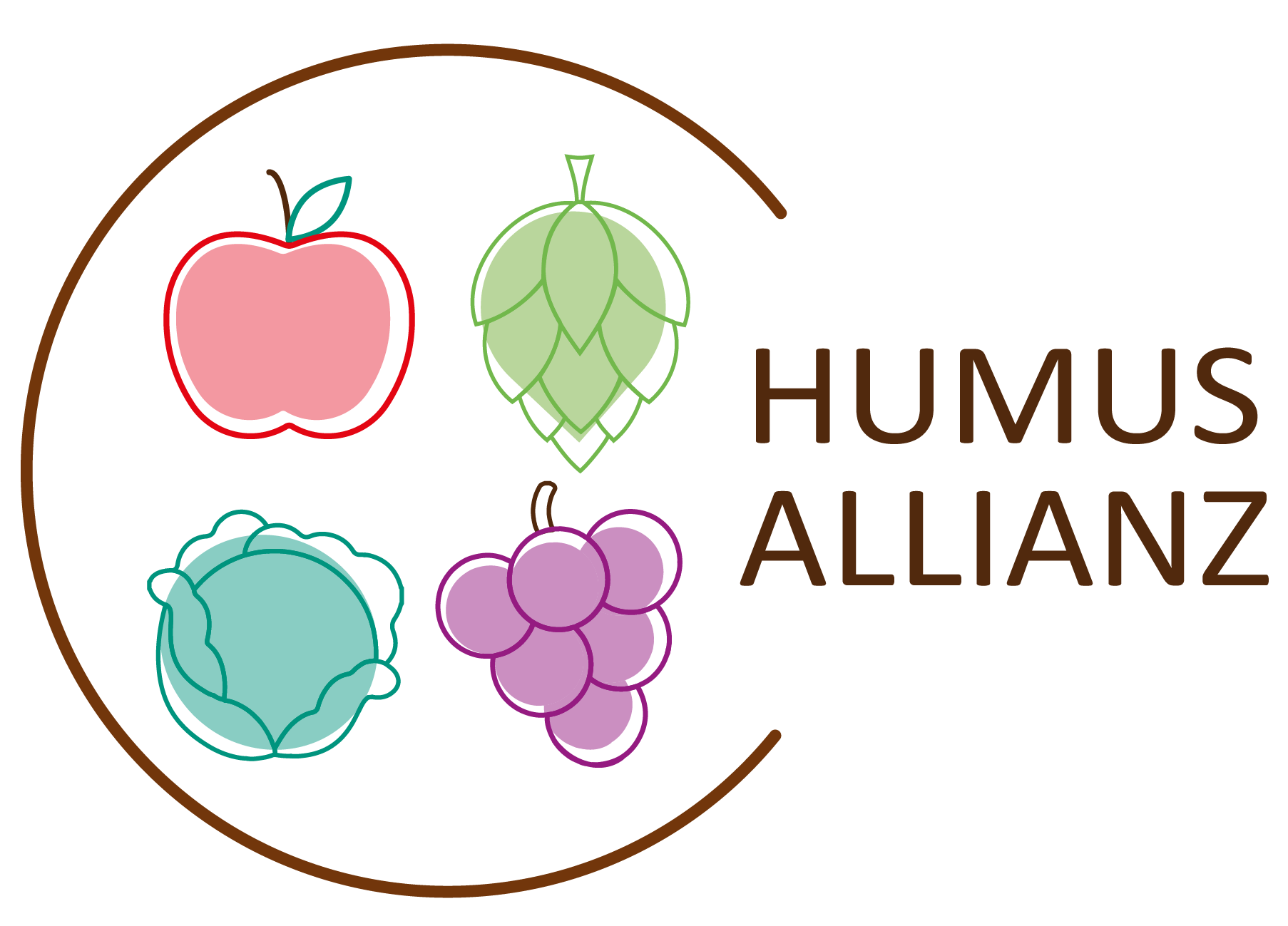Inhalt: Maßnahmenübersicht im Modell- und Demonstrationsvorhaben Optimierung des Humusmanagements im Hopfenanbau
Zwischenfruchteinsaat
Einsaat einer abfrierenden Mischung im Sommer & (Direkt-) Saat einer winterharten Begrünung im Herbst
Durch diese Maßnahme wird eine ganzjährige Begrünung zwischen den Bifängen geschaffen. Dabei bilden die Zwischenfrüchte ober- und unterirdische Biomasse aus, welche anschließend durch die Einarbeitung als organische Substanz in den Boden eingehen. Dies regt einerseits das Bodenleben an und fördert andererseits die Humusbildung.
Im Zeitraum zwischen der Einarbeitung und dem Auflaufen der Zwischenfrüchte ist der Boden zwischen den Bifängen besonders erosionsgefährdet. Durch die Direktsaat ist der Boden so lange durch die Sommerzwischenfrucht geschützt, bis die Winterzwischenfrucht ausreichend etabliert ist.
Die Direktsaat selbst führt zu keinem zusätzlichen Humusaufbau. Vielmehr kommt es im Vergleich zur konventionellen Bodenbearbeitung zu einer vertikalen Umverteilung. Ohne die Wendung des Bodens reichert sich der Humus im oberflächennahen Bodenbereich an, während dieser in der Tiefe zurück geht. Jedoch bietet die Direktsaat verschiedene Vorteile:
- Förderung des Bodenlebens, z.B. Schonung von Regenwürmern
- Erosionsschutz durch Bodenbedeckung und erhöhte Infiltrationsrate
- Stabileres Bodengefüge und erhöhte Tragfähigkeit
- Geringerer Energie- und Arbeitszeitbedarf
Einmalige Einsaat im Sommer mit abfrierenden und winterharten Komponenten
Ähnlich wie die Direktsaat der winterharten Zwischenfrucht bewirkt auch die einmalige Aussaat gemeinsam mit der Sommerzwischenfrucht einen erhöhten Erosionsschutz. Im Vergleich zu einer Einarbeitung der Sommerzwischenfrucht und anschließender Einsaat im Herbst wird eine dauerhaft geschlossene Pflanzendecke gewährleistet. Im Gegensatz zur Maßnahme der Direktsaat wird jedoch keine spezielle Sätechnik benötigt.
Dauerbegrünung
Zwischen den Bifängen wird eine Mischung eingesät, welche über den gesamten Projektzeitraum bestehen. Aufgrund der längeren Standzeit wird mehr Wurzel-Biomasse ausgebildet als bei einer herkömmlichen Zwischenfrucht. Der Boden ist dauerhaft bedeckt, wodurch er vor Erosion und Austrocknung geschützt ist. Zudem verbessert sich die Bodenstruktur und Befahrbarkeit. Durch regelmäßiges Mulchen oder Mähen des Aufwuchses gelangt zusätzliche organische Substanz in den Boden. Die mehrjährige Bodenruhe fördert das Bodenleben und hat einen positiven Effekt auf den Humusgehalt.
Aufgrund der reduzierten Bodenbearbeitung und dem dichten Bewuchs kann es zu einem erhöhten Aufkommen von Feld- und Schermäusen kommen. Deshalb ist auf eine regelmäßige Überwachung, die Förderung natürlicher Gegenspieler und ggf. die Durchführung direkter Bekämpfungsmaßnahmen zu achten.
Kombination: Dauerbegrünung & „herkömmliche ZF“ im Reihenwechsel
In dieser Maßnahme werden in den Reihen abwechselnd eine Zwischenfrucht und eine Dauerbegrünung etabliert. Dabei werden die Reihen mit Dauerbegrünung als Spritzgassen verwendet, was die Befahrbarkeit erhöht und Bodenverdichtungen vorbeugt. Im Vergleich zu einer ganzflächigen Zwischenfruchteinsaat kann mit der anteiligen Dauerbegrünung mehr Humusaufbau erfolgen.
Da in jeder zweiten Reihe eine regelmäßige Bodenbearbeitung durchgeführt wird, reduziert sich die Gefahr eines Feld- oder Wühlmausbefalls.
Zwischenfruchtmanagement
Regelmäßiges Walzen der Zwischenfrüchte
Das regelmäßige Walzen drückt die Zwischenfrüchte zu Boden und erzeugt so eine dichte Pflanzenmatte, welche vor Erosion schützt, Unkraut unterdrückt und die Verdunstung reduziert. Die Konkurrenzkraft der Zwischenfrucht um Wasser und Nährstoffe wird gemindert, was dem Hopfen zugutekommt. Obwohl die mehrmalige Überfahrt Dieselverbrauch und somit CO2-Emissionen bedeutet, soll dies durch die nachstehenden, positiven Effekte überlagert werden:
- Reduktion der Bodenbearbeitung
- Anregung der Bestockung und des Wurzelwachstums
- Lebendverbauung (Verarbeitung bodennaher, durch das Walzen abgestorbener Pflanzenteile durch das Bodenleben)
Beweidung der Zwischenfrüchte mit Schafen, Rindern & Legehennen
Durch die Beweidung führt man den Hopfengarten einer weiteren Nutzung zu. Die Nutztiere fressen dabei die Zwischenfrucht und versorgen dem Boden über ihre Ausscheidungen mit hochwertigem organischem Dünger. Die Beweidung findet entweder dauerhaft (Legehennen) oder nach der Ernte im Herbst (Rinder, Schafe) statt.
Flaches Einarbeiten der Zwischenfrüchte mit Fräse
Durch die sehr flache Bearbeitung kann die Zwischenfrucht in den Boden eingebracht werden, ohne die Bodenstruktur zu stören. Es findet eine Flächenrotte statt, wodurch das Material langsam an der Oberfläche zersetzt wird und Regenwürmern sowie Mikroorganismen beständig Nahrung bietet. Die Bodenbedeckung bietet dem Boden Schutz vor Erosion und Austrocknung.
Bodenbearbeitung
Reduzierung der Bodenebarbeitung auf dem Bifang
In der Praxis werden die Bifänge im Herbst oder Frühjahr beim Anrainen für gewöhnlich weggeackert. Dies geschieht im Vorfeld des jährlichen Rückschnitts der sich im Boden befindlichen Hopfenstöcke. Durch Kombigeräte ist es nun jedoch möglich, die beiden Arbeitsschritte zu kombinieren.
Indem somit eine Bodenbearbeitung weggelassen wird, reduziert sich entsprechend der Arbeits- und Kraftstoffeinsatz. Zudem wird das Bodengefüge geschont, Bodenverdichtungen vermieden und vor Erosion geschützt.
Management der Ernterückstände (Rebenhäcksel)
Kompostierung der Rebenhäcksel (z. B. MC-Kompost)
Aus phytosanitären Gründen sollten keine frischen Rebenhäcksel in die Hopfengärten zurückgeführt werden, da ansonsten Pilzkrankheiten überdauern und im Folgejahr zur Neuinfektion von Hopfenpflanzen führen können. Durch eine Kompostierung und die dabei erreichten Temperaturen werden die Rebenhäcksel teilweise hygienisiert. Dabei gibt es sowohl bei der erreichten Temperatur als auch bei den Abbau- und Umsetzungsprozessen Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen der Kompostierung. Als organischer Dünger wirkt der Kompost humusmehrend und kommen zugleich der Bodenstruktur und dem Bodenleben zugute.
Vergärung der Rebenhäcksel in der Biogasanlage & Ausbringung auf den Hopfenflächen
Eine weitere Möglichkeit ist die Vergärung der Rebenhäcksel in einer Biogasanlage. Die entstehenden Gärreste können im Anschluss in den Hopfengärten ausgebracht werden. Somit werden die Rebenhäcksel nicht nur als organische Dünger, sondern zugleich auch zur Energie- und Wärmegewinnung genutzt, wodurch fossile Energieträger ersetzt werden können.
Ausbringung „flächenfremder“ organischer Dünger
Ausbringung von Kompost/Grünschnitt
Kompost und Grünschnitt sind positiv für die Bodenfruchtbarkeit. Die organische Substanz fördert das Bodenleben, die darin enthaltenen Huminstoffe wirken humusmehrend. Weitere positive Effekte sind die Verbesserung der Bodenstruktur und des Erosionsschutzes.
Beim Einsatz von flächenfremdem Material steht jedoch der Kohlenstoffanreicherung auf der Ausbringungsfläche der Entzug auf einer anderen Fläche gegenüber. Sinnvoll ist deshalb vor allem eine Verwendung von Ausgangsmaterial, für welches ansonsten keine Verwendung bestehen würde. Beispielsweise bietet sich an:
- Das Mähgut von Straßenbegleitgrün oder anderen Eh-da-Flächen.
- Material aus der Landschaftspflege, bspw. bei Abfuhr des Schnittguts aus naturschutzfachlichen Gründen zur Ausmagerung.
Mulchen der Bifänge mit organischem Material (Stroh, Grasschnitt) zur Unkrautunterdrückung
Zu den bei der Maßnahme „Ausbringung von Kompost/Grünschnitt“ genannten Vorteilen kommt beim Mulchen der Bifänge hinzu, dass Unkräuter unterdrückt werden. Gegebenenfalls können somit mechanische oder chemische Maßnahmen zur Unkrautbekämpfung ersetzt werden. Die Abdeckung und Beschattung der Bifänge bewirkt zudem eine geringere Verdunstungsrate, wodurch dem Hopfen mehr Wasser zur Verfügung steht.
Auch für das Mulchen ist es zielführend, überschüssiges Stroh oder Grasschnitt aus der Landschaftspflege zu verwenden.
Einmischen von (regionaler) Pflanzenkohle in den Rebenhäcksel-Kompost
In den Boden eingebrachte Pflanzenkohle führt aufgrund der stabilen Kohlenstoffverbindungen zu einer langfristigen C-Sequenstrierung. Auch nach der Ausbringung bewirken im Boden ablaufende Prozesse eine fortführende Kohlenstoffanreicherung (Blanco-Canqui et al. 2020). Neben einem hohen Wasserhaltevermögen besitzt Pflanzenkohle die Fähigkeit, Nährstoffe zu binden. Damit es nach der Ausbringung nicht zu einem Mangel an pflanzenverfügbaren Nährstoffen für den Hopfen kommt, empfiehlt es sich, diese gemeinsam mit organischen Düngern wie Rebenhäcksel oder Kompost auszubringen.
Auch Pflanzenkohle stellt zunächst eine flächenfremde Zufuhr an Kohlenstoff dar. Sofern die Kohlenstoffmenge durch eine entsprechende Abgabe an Rebenhäcksel ausgeglichen wird, kann jedoch von einer zusätzlichen Speicherung gesprochen werden, da der Kohlenstoff in der Pflanzenkohle bedeutend stabiler im Boden verbleibt als der in den Rebenhäckseln.