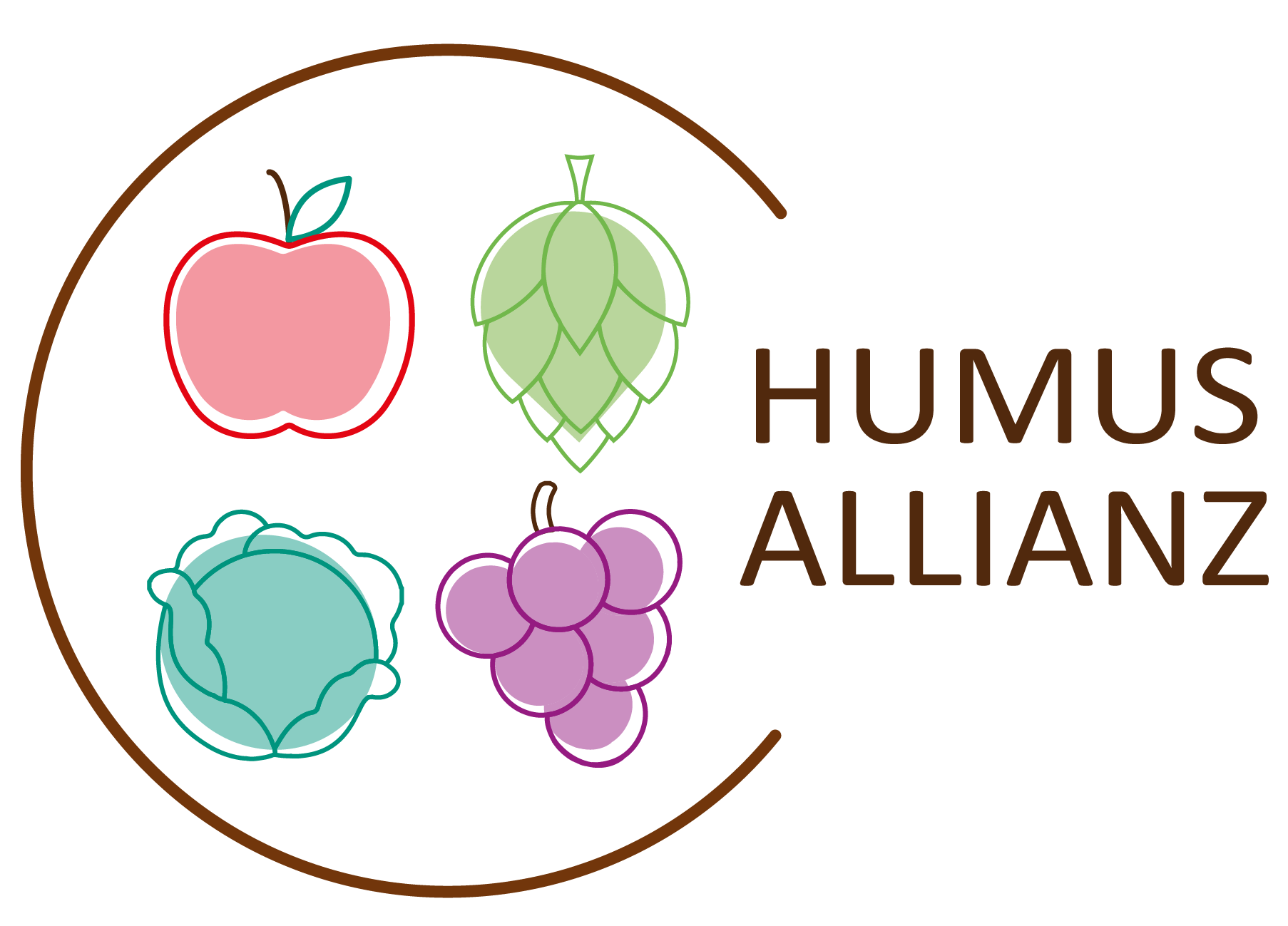Inhalt: Maßnahmenkatalog Modell- und Demonstrationsvorhaben Humusaufbau im Weinbau
Im Rahmen des MuD CarboVino setzen teilnehmende Betriebe ausgewählte Maßnahmen zur Förderung des Humusaufbaus im Weinberg um. Dabei stehen Ihnen fünf verschiedene, wissenschaftlich fundierte Maßnahmen zur Förderung des Humusaufbaus im Weinberg zur Verfügung. Diese umfassen die Einsaat einer humusfördernden Begrünung, reduzierte Bodenbearbeitung, den Einsatz von Pflanzenkohle, Beweidung mit Schafen und die Integration von Bäumen in den Weinberg (Vitiforst). Die Maßnahmen werden über die gesamte Projektlaufzeit durchgeführt.
Begrünung durch humusfördernde Einsaat
- Einsaat humusfördernder Begrünung in jeder zweiten Gasse
- Verwendung artenreicher Begrünungsmischung mit Raphanus sativus (Ölrettich), Lolium multiflorum (Welsches Weidelgras), Trifolium pratense (Rotklee), Tripholium repens (Weißklee), Malva sylvestris (Malve), Sinapsis alba (Gelbsenf), Carthamus tinctorius (Färberdistel)
- Wechsel der Gassenbegrünung alle 2-3 Jahren
- Walzen statt Mulchen zur schonenden Begrünungspflege
Eine Begrünung zwischen den Rebzeilen ist im Weinbau bereits etablierte Praxis – sie schützt vor Erosion, verbessert die Befahrbarkeit und fördert die Biodiversität. Im Projekt sollen für diese positiven Effekte und den Humusaufbau im Boden gezielt humusfördernde Begrünungsmischungen eingesät werden. Dabei liefern Arten wie Ölrettich und Phacelia oberirdische Biomasse, während tiefwurzelnde Arten wie Weiß- oder Rotklee Wurzeleinträge liefern, die durch Bodenorganismen in stabile Humusformen umgewandelt werden können. Die Einsaat der Begrünung erfolgt in jeder zweiten Gasse. Die Gassen werden nach 2-3 Jahren gewechselt, sodass der Eintrag ober- und unterirdischer Biomasse über die gesamte Projektfläche erfolgt. Die hochgewachsene Begrünung soll gewalzt statt gemulcht werden. Dies hat den Vorteil, dass Pflanzenmasse niedergelegt wird, ohne sie abzutrennen. Die dadurch entstehende lebendige Mulchschicht reduziert nicht nur die Verdunstung und sorgt für Bodenbedeckung, sondern begünstigt auch die Aktivität der Wurzeln und den Erhalt der Mikrofauna und –flora.
Reduzierte Bodenbearbeitung
- Reduktion der Überfahrten durch geringere Arbeiten im Zwischenstockbereich
- Einsatz von Drohnen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln
Durch den Verzicht auf häufiges Befahren der Gassen bleibt der Boden in seiner Struktur erhalten und die Aktivität der Bodenorganismen wird gefördert, sodass sich Humus stabilisieren kann. Intensive mechanische Eingriffe beschleunigen den Abbau organischer Substanz – daher wirkt sich ein reduziertes Bearbeitungsregime langfristig positiv auf die Humusbilanz aus.
Einsatz von Pflanzenkohle
- Ausbringung von 1,5 t/ha Pflanzenkohle gemeinsam mit hochgewachsener Begrünung
- Einarbeitung durch Mulchen der Begrünung
Pflanzenkohle ist ein stabiler, kohlenstoffreicher Feststoff, der durch die pyrolytische Verkohlung von Biomasse unter Sauerstoffausschluss entsteht. Aufgrund ihrer chemischen Stabilität bleibt der enthaltene Kohlenstoff so über Jahrhunderte gebunden. Darüber hinaus besitzt Pflanzenkohle eine hohe spezifische Oberfläche, die Wasser, Nährstoffe und Mikroorganismen binden kann und dadurch die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert. Im Projekt wird Pflanzenkohle gemeinsam mit der bestehenden Begrünung in den Boden eingearbeitet. Dieses Vorgehen kombiniert organisches Material mit der Pflanzenkohle und untersützt somit gezielt den Humusaufbau.
Schafbeweidung
- Wiederholte Beweidung zur Einbringung von Pflanzenresten und organischem Dünger (Kot)
- Sommerbeweidung vor Knospenausbruch und/oder Winterbeweidung nach Ernte
Der Einsatz von Schafen zur extensiven Pflege der Begrünung ist im Weinbau – insbesondere im ökologischen Anbau – bereits verbreitet. Die Tiere beweiden die Flächen schonend und ermöglichen dadurch eine natürliche Begrünungspflege, bei der auf mechanische Maßnahmen wie Mähen oder Mulchen verzichtet werden kann. Das schont die Bodenstruktur und wirkt Bodenverdichtung entgegen.
Schafe tragen außerdem aktiv zur Förderung des Humusaufbaus bei. Die selektive Beweidung regt das Wachstum der Pflanzen an, wodurch es zu einer erhöhten Wurzelbildung und damit zu mehr Wurzeleintrag in den Boden kommt. Gleichzeitig liefern Kot und Harn wertvolle organische Substanz, die von Bodenorganismen zersetzt und in Humus umgewandelt wird. Die Trittwirkung der Tiere unterstützt dabei die Einbringung dieses Materials in den Boden. Die Kombination aus kontinuierlicher Begrünung, organischem Eintrag und minimalem Maschineneinsatz schafft ideale Voraussetzungen für mikrobielle Aktivität und langfristige Kohlenstoffspeicherung im Boden.
Vitiforst
- Pflanzung von standortangepassten Gehölzarten in oder an Weinbergsflächen
- Anlage von Hecken, Baumreihen oder Einzelbäumen entlang der Rebzeilen oder Parzellengrenzen
- Nutzung von Schnittgut als Mulchmaterial in den Rebflächen
Mit der Maßnahme Vitiforst werden dauerhaft Gehölzstreifen, z.B. in Form von Wertholzbäumen, zwischen den Rebzeilen etabliert. Auf diese Weise entstehen kombinierte Nutzungssysteme, bei denen Reben und Gehölze auf derselben Fläche wachsen. Solche Strukturen bieten ein hohes Potenzial zur Kohlenstoffbindung: Neben dem Humusaufbau im Boden speichern die Gehölze große Mengen Kohlenstoff in ihrer ober- und unterirdischen Biomasse. Darüber hinaus tragen die Gehölze zu ökologischen Zusatzleistungen wie Erosionsschutz, verbesserter Wasserhaltefähigkeit und Mikroklimaregulation bei.
Im Projekt werden die Systeme individuell auf die jeweiligen Betriebe abgestimmt. Standortbedingungen, betriebliche Zielsetzungen und Bewirtschaftungsabläufe werden bei der Planung der Gehölzstreifen berücksichtigt. Ziel der Maßnahme ist es, langfristige klima- und humuswirksame Strukturen zu schaffen, die sich funktional in die Weinbergsbewirtschaftung integrieren lassen.